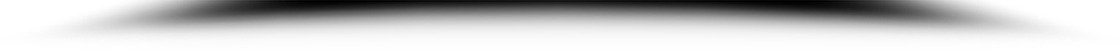Weinähr ist das Tor zum schönen Gelbachtal und gleichzeitig der Anfang vom Westerwald. Dabei liegt die kleine Ortsgemeinde mit rund 450 Einwohnern mitten im Städte-Dreieck Koblenz (ca. 35km), Limburg a.d. Lahn (ca. 30km) und Montabaur (ca. 20km). Die Lahn selbst ist auch nur 1km von Weinähr entfernt.
Weinähr besticht im Ortskern mit seinen Fachwerkhäusern, wovon das historische Rathaus von 1571 im Mittelpunkt steht. Im 20. Jahrhundert war Weinähr als Erdbeer- und Weindorf bekannt, welches in seiner Blütezeit über 10 Einkehrmöglichkeiten mit Gaststätten, Kneipen und Staußwirtschaften besaß.
Heute lädt Weinähr vor allem zum Spazieren, Wandern und Radfahren ein und bietet mit dem LahnWeinStieg ein echtes Wander-Highlight.
Die erste Erwähnung Weinährs
Aufgrund der günstige topographischen Lage Weinährs, liegt die Besiedlung des Ortes wohl weit vor der Zeit der ersten namentlichen Nennung im Jahr 1267.
Weinähr wird in einer Schenkungsurkunde zugunsten des Kloster Arnstein an der Lahn, als „Anre“ benannt. Der Name rührt wohl von der Bezeichnung des Gelbaches her, der im 10. Jahrhundert als „Anara“ in den Urkunden erscheint.
Interessant dabei ist, dass die erste Erwähnung des Ortsnamens und das erste Zeugnis des über Jahrhunderte bedeutendsten Wirtschaftsfaktors der Region dem Weinbau- in einer Urkunde erscheinen.
Da die tatsächlichen Anfänge von Weinähr leider im Dunkeln liegen, wurde 1952 die Ortsgeschichte mit der 700-Jahrfeier offiziell festgestellt.
Das Kloster Arnstein
Weinähr lag im Herrschaftsbereich der reichsunmittelbaren Prämonstratenser- Abtei Arnstein. Der Abt des Klosters war Grundherr und hatte die weltliche Gerichtsbarkeit inne. Er ernannte Schöffen und den Ortsvorsteher. Verbunden mit der geistlichen Orientierung der Landesherren im Zuge der Reformation, befand sich Arnstein ab 1555 zwischen protestantischen Herrschaften eingeschlossen. Zur Wahrung der eigenen Interessen, suchte das Kloster den Schutz des mächtigen Kurtrier. Der Trierer Kurfürst versuchte sich Arnstein einzuverleiben und untergrub nach und nach die Souveränität der kleinen Abtei. De facto konnte Arnstein seit Mitte des 16. Jahrhunderts nicht mehr unabhängig regieren.
Nach dem verheerenden 30-jährigen Krieg, versuchten die Mönche des Klosters das entvölkerte Territorium wieder zu besiedeln und die brachen Flächen zu rekultivieren.
Im Zuge der Säkularisierung (ab 1803) wurde das Kloster aufgelöst und Weinähr eine Gemeinde im Herzogtum Nassau.
Der Bergbau
Bereits im späten 16. Jahrhundert finden sich Hinweise auf ein Hammerwerk in Weinähr. Industriellen Charakter bekam die Verhüttung von Eisenerz, sowie der Abbau von Kupfer, Blei und Silber, erst seit 1660. Der Niederländer Marioth aus Lüttich errichtete zu dieser Zeit ein Hüttenwerk im Gelbachtal. Die Familie bewohnte die Burg Langenau und errichtete das barocke Hauptgebäude. Der Bergbau prosperierte und bildete seit dem späten 18. Jahrhundert den bedeutendsten Wirtschaftsfaktor im Tal.
Bis in die 1950er Jahre wurde in mehreren Gruben geschürft, die Bergleute litten allerdings unter der schweren körperlichen Arbeit und der schlechten Bezahlung. Die erst vielversprechende Arbeit, sorgte dafür, dass die meisten Grubenarbeiter schon in jungen Jahren an den Folgen starben.
Der Weinbau
Die Rebflächen werden 1267 zum ersten Mal erwähnt. Auf die Initiative des Klosters Arnstein, wurden jedoch vermutlich schon im 12. Jahrhundert die ersten Reben gesetzt. Da die Setzreben aus dem Burgund stammten, ist davon auszugehen, dass es sich um den Pinot Noir oder die Gamay- Rebe handelte. Im Weinährer Kelterhaus (Arnsteiner Hof), wurden sowohl die Trauben aus den Arnsteiner Wingerten, als auch die von verpachteten Rebflächen gekeltert und ausgebaut.
Die ursprünglich 48 verschiedenen Parzellen verschmolzen 1971 unter dem ältesten bekannten Namen Giebelhöll (1302 „Gyvelhelde“), zu einer Lage. Der, in der Gemarkung Weinähr überwiegend vorherrschende graue und blaue Devonschiefer, bietet sehr gute Voraussetzungen für den Weinbau. Manche Parzellen verfügen jedoch auch über stark verwitterte Schieferböden mit einem hohen Lehmanteil.
Bis ins 19. Jahrhundert lag der Schwerpunkt auf dem Rotweinanbau (sog. schwarzer Burgunder), erst seit dem Zuzug etlicher Moselwinzer (ab 1880) wird hier Riesling kultiviert.
Die preußische Lagenklassifikation weist über 70%, der im 19. Jahrhundert bebauten Rebfläche, als Lagen der Klasse 1 aus. In einem Reiseführer vom Anfang des 20. Jahrhunderts heißt es zur Qualität der Weine: …der Rothe ähnelt dem Assmannshäuser…!
Die Mühlen
Der Gelbach wurde nachweislich seit dem frühen 14. Jahrhundert dazu genutzt, Mühlen zu betreiben. Der Deutsche Orden in Koblenz hatte seit 1302 Besitz in Weinähr und nannte auch eine Mühle sein Eigen. Bis zu fünf Mühlräder nutzten die Kraft des aufgestauten Gelbachs, um Ölfrucht und Korn zu mahlen, bzw. um das Hammerwerk zu betreiben.